Warum Lesbarkeit für deinen Text wichtig ist –
und wie dir die Flesch-Formel dabei hilft!
Wenn du einen Text schreiben und veröffentlichen möchtest, dann hast du dir wahrscheinlich schon jede Menge Gedanken darüber gemacht, welchen Inhalt dieser Text haben soll. Hast dir überlegt, welche Schwerpunkte du setzt und in welcher Reihenfolge du sie präsentierst.
Aber hast du dir auch Gedanken darüber gemacht, wie dein Text für deine Zielgruppe möglichst gut lesbar ist? Was bedeutet überhaupt „Lesbarkeit“? Gibt es dafür einen Maßstab, und wenn ja, wie sieht dieser aus? Und was kannst du tun, um einen gut lesbaren Text zu schreiben?
Warum die Lesbarkeit deines Textes für dich als Autor so wichtig ist und wie die Antworten auf die gerade gestellten Fragen aussehen, möchte ich dir im folgenden Beitrag schildern.
- Warum Lesbarkeit für (d)einen Text wichtig ist
- Wie du die Lesbarkeit deines Textes messen kannst
- Die deutsche Flesch-Formel
- Wie kann ich verständlicher schreiben? Von Robert Fleschs Grundidee…
- … zum Hamburger Verständlichkeitsmodell
- Fazit
- Was bedeutet das für dich als Autor eines Sach- oder Fachbuchs?
Warum Lesbarkeit für (d)einen Text wichtig ist
Wann immer du einen Text schreibst und veröffentlichst, möchtest du natürlich auch, dass dieser Text zur Kenntnis genommen und verstanden wird. Das gilt für fast alle Texte: Angefangen beim Warnschild über die Bedienungsanleitung bis hin zum Zeitungsartikel oder zur wissenschaftlichen Arbeit. Und damit das klappt, muss dieser Text zunächst einmal für den oder die gedachten Rezipienten wahrnehmbar platziert werden: am Baustellenzaun, auf der Waschmaschine, in der Zeitung oder dem wissenschaftlichen Magazin deiner Wahl – oder in deinem Blog.
Dadurch, dass dein Text wahrnehmbar ist, hast du aber nur den ersten Schritt getan. Damit man ihn versteht, benötigst du noch ein paar weitere Schritte. Denn alle Wahrnehmbarkeit nützt dir nichts, wenn deine Zielgruppe den Text zwar sehen, aber nicht lesen kann. Und damit ist nicht die formale, äußere Lesbarkeit gemeint (das Warnschild wurde verschmiert, die Schriftgröße der Bedienungsanleitung ist zu klein, die Typographie beim Zeitungsartikel oder der wissenschaftlichen Arbeit ist dem Lesefluss nicht zuträglich), sondern die inhaltliche Lesbarkeit!
Wenn du möchtest, dass dein Text von deiner Zielgruppe verstanden wird, dann muss er für diese Zielgruppe lesbar sein!
Was bedeutet das für dich? Das bedeutet für dich als Verfasser, dass du dir zunächst einmal darüber Gedanken machen solltest, für welche Zielgruppe du schreibst. Und dann deine Texte in ihrer Lesbarkeit an deren Lese- und Verständnisfähigkeiten anpasst. Das kann im Einzelfall dazu führen, dass du ein und dieselbe Botschaft in sehr unterschiedlichen Texten präsentieren musst. Gute Beispiele dafür sind die Übersetzung komplexer wissenschaftlicher Themen in klare Handlungsanweisungen für alle Teile der Bevölkerung (wie im Falle einer Pandemie), die Umwandlung behördlicher Texte in leichte Sprache, oder das Schreiben von Sach- oder Fachbüchern, bei denen es auf die richtige Balance von Expertise und Verständlichkeit ankommt.
Wie du die Lesbarkeit deines Textes messen kannst
Damit kommen wir zur Kernfrage: Wie kannst du die Lesbarkeit deiner Texte messen und einordnen? Gibt es dafür Methoden und Werkzeuge? Zum Glück lautet die Antwort: Ja, die gibt es, denn diese Frage hat Experten natürlich schon lange beschäftigt! Ein Meilenstein war die Entwicklung des „Flesch reading ease test“ durch Rudolf Flesch im Jahr 1949. Rudolf Flesch war ein in Österreich aufgewachsener Jurist, Autor und Sprachexperte, der sich Zeit seines Lebens mit der Frage des verständlichen Gebrauchs der (englischen) Sprache auseinandergesetzt hat. Seine Lesbarkeitsformel basiert auf zwei Erkenntnissen: zum einen darauf, dass kürzere Sätze leichter zu verstehen sind als lange. Zum anderen darauf, dass Worte mit wenigen Silben grundsätzlich leichter zu verstehen sind als solche mit vielen. Auf dieser Basis entwickelte er dann die folgende Formel für seinen „Flesch reading-ease score“ (FRES):
206,835 – 1,015 x ASL – 84,6 x ASW
Dabei steht ASL für die durchschnittliche Satzlänge (average sentence length) und ASW für die durchschnittliche Anzahl von Silben pro Wort (average number of syllables per word). Je höher dann im Ergebnis der Lesbarkeitsindex ist, desto leichter verständlich ist der Text:
| Flesch-Reading-Ease-Wert von… bis unter… |
Lesbarkeit | Verständlich für |
| 0 – 30 | Sehr schwer | Akademiker |
| 30 – 50 | Schwer | |
| 50 –60 | Mittelschwer | |
| 60 – 70 | Mittel | 13- bis 15-jährige Schüler |
| 70 –80 | Mittelleicht | |
| 80 – 90 | Leicht | |
| 90 – 100 | Sehr leicht | 11-jährige Schüler |
Dabei gilt es zu beachten, dass dieser Index nur für Fließtexte gedacht ist. Für Tabellen oder Aufzählungen ist er nicht geeignet, da hier aufgrund fehlender Satzzeichen keine durchschnittliche Satzlänge ermittelt werden kann. Wegen dieses Kriteriums ist es außerdem sinnvoll, längere Textabschnitte zu prüfen, die auch mehrere Sätze beinhalten. Je mehr Sätze der überprüfte Abschnitt enthält, umso zuverlässiger ist das Ergebnis.
Jetzt stellt sich die Frage: Kann eine solche Formel tatsächlich ausreichend genau Aufschluss über die Lesbarkeit eines Textes geben? Sie berücksichtigt doch nur die beiden Kriterien Satzlänge und Silbenzahl! Das ist tatsächlich eine naheliegende Frage. Schaut man aber genauer hin, dann zeigt sich, dass diese beiden Kriterien mit verschiedenen anderen Kriterien verknüpft sind. Es werden also zwar nur zwei Eigenschaften eines Textes gemessen. Gleichzeitig werden damit aber verschiedene andere Kriterien ebenfalls berücksichtigt, ohne dass dies zunächst erkennbar ist. Dennoch sind die Ergebnisse natürlich mit einer gewissen Unschärfe behaftet.
Daher kann es auch in Einzelfällen zu etwas kuriosen Ergebnissen kommen, die dann oft in der sehr spezifischen Natur der zugrundeliegenden Texte wurzeln. Während das Buch „Moby Dick“ von Herman Melville so einen durchschnittlichen Lesbarkeitsindex von 57,9 besitzt, kommt ein besonders langer Satz über Haie in Kapitel 64 auf einen Wert von -146,77. Ein Satz zu Anfang von Marcel Prousts „Swann’s Way“ (deutsch: „In Swanns Welt“) kommt auf einen Wert von -515,1. Das liegt im ersteren Fall daran, dass der Satz mehrere durch Semikola geteilte Halbsätze enthält, ein Semikolon aber nicht als vollständige Satztrennung gilt, sondern nur ein Punkt. Im zweiten Fall werden fast 600 Worte ausschließlich durch Semikola, Doppelpunkte und Gedankenstriche getrennt. In beiden Fällen ist deshalb die durchschnittliche Satzlänge extrem hoch. Das erschwert tatsächlich die Lesbarkeit drastisch und erklärt damit den erreichten Negativwert hinreichend.
Deshalb ist diese Formel in der Forschung weitgehend etabliert, obwohl sie eher eine grobe Einschätzung und keine hochpräzise Messung beinhaltet. Auch außerhalb der Forschung fand sie schnell Verbreitung und ist heute ein anerkanntes Mittel zur Bestimmung von Lesbarkeit in den Vereinigten Staaten. So schreiben bspw. einige Bundesstaaten einen Mindest-Flesch-Score von 45 für Versicherungspolicen vor.
Die deutsche Flesch-Formel
Was sehr schnell erkennbar ist: Ein Lesbarkeitsindex, der auf der Verwendung von Silbenzahlen und Satzlängen basiert, ist zwangsläufig immer von der Sprache abhängig, für die er benutzt wird. Weil in der deutschen Sprache zum einen deutlich längere Sätze üblich sind, zum anderen aber auch die durchschnittliche Silbenanzahl pro Wort höher ist, musste die Formel von Robert Flesch entsprechend angepasst werden. Diese Anpassung erfolgte 1978 durch Toni Amstad. Seine bis heute gültige Flesch-Formel für die deutsche Sprache lautet daher:
Lesbarkeitsindex FRE(deutsch) = 180 – ASL – 58,5 x ASW
Zur Einstufung des Ergebnisses gilt unverändert die oben abgebildete Tabelle.
Bevor du jetzt anfängst, deine Texte selbst in Silben zu zerlegen und Wörter und Satzlängen zu zählen: Unter www.fleschindex.de findest du ein einfaches Tool, in das du deine Texte hinein kopieren und sofort den deutschen Flesch-Index ablesen kannst.
Wie kann ich verständlicher schreiben? Von Robert Fleschs Grundidee…
Jetzt hast du also frohen Mutes deinen Text mit der oben genannten Webseite getestet – und stellst fest, dass der Lesbarkeitsindex doch höher liegt, als du gehofft hast. Und du fragst dich: „Was kann ich tun, um verständlicher zu schreiben?“
Die ersten beiden Tipps dazu kommen von Robert Flesch selbst:
- Schreib in kurzen, prägnanten Sätzen! Mach aus einem langen Satz mehrere kurze!
- Ersetze komplexe, lange Wörter durch einfachere, kürzere!
Erkennbar hilft dir das aber nur in Bezug auf deinen Flesch-Score – und berücksichtigt dabei nicht die anderen Aspekte, die für eine bessere Verständlichkeit deines Textes sorgen. Deshalb möchte ich dich an dieser Stelle auf das Hamburger Verständlichkeitsmodell hinweisen:
… zum Hamburger Verständlichkeitsmodell
Das Hamburger Verständlichkeitsmodell wurde von den Psychologen F. Schulz von Thun, I. Langer und R. Tausch auf Basis der Lesbarkeitsforschung entwickelt. Dabei beschränkten sie sich nicht wie Robert Flesch auf zählbare Merkmale wie Silbenanzahl pro Wort oder Wörter pro Satz. Vielmehr werden beim Hamburger Verständlichkeitsmodell auch die Struktur eines Textes und seine Zielgruppe berücksichtigt. Die Grundidee dabei ist, dass Informationen leichter erfasst werden können, wenn ein Text übersichtlich gegliedert ist, und dass ein interessant gestalteter Text leichter die Aufmerksamkeit der Leser gewinnt.
Dieses Modell ist bei einigen Wissenschaftlern und Linguisten umstritten, weil es aus ihrer Sicht keine ausreichende theoretische Basis hat. Dafür ist es aber bei Praktikern, die sich mit der deutschen Sprache befassen, fast zum Standard geworden, und bewertet die Verständlichkeit von Texten mithilfe von vier Säulen, die als „Verständlichmacher“ bezeichnet werden. Diese vier Säulen sind:
1. Einfachheit
Einfachheit bezieht sich an dieser Stelle nicht auf den zu vermittelnden Inhalt, sondern auf die sprachliche Formulierung, mit der dies geschieht. Je einfacher deine Texte sind, umso leichter können sie verstanden werden. Wichtig sind deshalb Satzbau und Wortwahl. Ich empfehle dir daher:
- Schreib in kurzen Sätzen.
- Verwende kurze und geläufige Begriffe.
- Wenn die Verwendung von Fremdworten nötig ist, erläutere sie.
- Platziere Nebensätze nicht mitten in Hauptsätzen, sondern davor oder danach.
2. Gliederung und Ordnung
Texte werde besser verstanden, wenn sie inhaltlich folgerichtig und äußerlich erkennbar gegliedert sind. Je besser ein Text gegliedert ist, umso leichter ist er zu verstehen. Das bedeutet für diesen Punkt:
- In deinem Text sollte ein roter Faden erkennbar sein (inhaltliche Folgerichtigkeit).
- Dein Text sollte durch optische Gliederungen übersichtlich gestaltet sein, so dass bspw. durch Überschriften, Formatierungen, Aufzählungen und Absätze erkennbar ist, was wesentlich ist und in Sinnzusammenhang steht (äußere Gliederung).
- Im Ergebnis soll sich die innere Ordnung deines Textes in seiner äußeren Gliederung widerspiegeln.
3. Kürze und Prägnanz
Dieser Aspekt ist etwas schwieriger zu handhaben als die vorigen, denn er bezieht sich auf den Sprachaufwand im Verhältnis zum Informationsziel. Während es also grundsätzlich gut ist, einen Text kurz und prägnant zu verfassen, steht dennoch das Erreichen dieses Ziels stets im Vordergrund. Ein extrem knapper Text erschwert das Verständnis daher ebenso wie ein zu weitschweifiger Text. Deshalb gilt:
- Halte deinen Text so kurz wie möglich – aber so lang wie nötig, um das Informationsziel zu erreichen.
- Verzichte auf alle nicht notwendigen Inhalte wie unnötige Einzelheiten, zusätzliche Informationen und Erläuterungen, breites Ausholen und Abschweifen vom Thema.
- Verzichte auf alle sprachlich nicht notwendigen Elemente wie weitschweifige Formulierungen, umständliche Erklärungen, Füllwörter, Fragen und Wiederholungen.
- Ein Satz wird verständlicher, wenn du häufiger Verben statt Substantive verwendest.
- Aktive Formulierungen sind leichter zu verstehen als passive.
4. Zusätzliche Stimulanz
Unter diesem Begriff werden Elemente verstanden, die zusätzlich zum Text beim Leser Interesse und persönliche Anteilnahme auslösen sollen. Noch stärker als beim vorigen Punkt solltest du hier aber das Informationsziel und die Zielgruppe im Hinterkopf behalten, denn ein übermäßiger Gebrauch dieser Elemente kann schnell ins Gegenteil umschlagen. Idealerweise bewegst du dich hier in einem Mittelmaß zwischen nüchtern und lebendig – und im Zweifel lieber etwas zurückhaltender als zu forsch! Denkbare Elemente sind:
- Bilder, Grafiken, Illustrationen
- anschauliche und konkrete Formulierungen
- direkte Ansprache des Lesers
- Einbettungen von Informationen in eine anregende Geschichte
- Reizwörter oder witzige und effekthaschende Formulierungen
5. Was du besser NICHT machst
Wenn man die Kriterien des Hamburger Verständlichkeitsmodells berücksichtigt, dann gibt es im Umkehrschluss ein paar Dinge, die du beim Schreiben eher vermeiden solltest, nämlich
- lange, verschachtelte Sätze
- passive Satzkonstruktionen
- den Nominalstil
- Modalverben (werden, können, sollen, müssen)
- Fachbegriffe, wenn sie nicht unumgänglich sind, sowie Abkürzungen
- Adjektive, Adverbialkonstruktionen und Partizipialkonstruktionen – außer, sie enthalten wichtige zusätzliche Information
- Füllwörter
Fazit
Wenn du das jetzt alles gelesen hast (und beherzigst), hast du einen großen Schritt in die Richtung gemacht, deine Texte zukünftig für dein Zielpublikum lesbarer zu gestalten. Das hat zum einen den Charme, dass du deinen Inhalt besser vermitteln kannst. Zum anderen steigt die Zufriedenheit deiner Leser und damit die Wahrscheinlichkeit, dass sie weitere Texte von dir lesen oder dich sogar weiterempfehlen! SEO-Analysten haben außerdem festgestellt, dass Texte mit guter Lesbarkeit grundsätzlich besser ranken, selbst wenn dieser Faktor derzeit noch nicht zu Googles offiziellen Rankingfaktoren gehört. Die Vermutung liegt also nahe, dass der Google-Algorithmus auch die Lesbarkeit von Texten berücksichtigt.
Die Flesch-Formel kann dir dabei schnell und einfach helfen, eine erste Einschätzung über die Lesbarkeit deines Textes zu bekommen. Vergiss dabei aber bitte nicht, dass eine Optimierung deines Textes in Bezug auf den Flesch-Index um jeden Preis keine gute Idee ist! Denn ein Text, der vielleicht ein wenig komplexer und schwieriger zu lesen ist, kann für einen versierten Leser durchaus angenehmer zu lesen sein als sein optimiertes Pendant, das wegen einer übereinfachen Sprache künstlich und nicht authentisch wirkt. Auch hier kommt es wieder sehr stark – wie bspw. bei Sach- oder Fachbüchern – auf die zu vermittelnden Inhalte und die Zielgruppe an. Die Flesch-Formel kann dir deshalb zwar eine gute erste Einschätzung geben, aber keinen professionellen Lektor, Texter oder Berater ersetzen!
Aber dafür hast du ja mich.
Was bedeutet das für dich als Autor eines Sach- oder Fachbuchs?
Nachdem jetzt klar ist, wie wichtig die Lesbarkeit eines Textes im Allgemeinen ist, möchte ich dir noch einmal deutlich machen, warum gerade du als Autor eines Sach- oder Fachbuchs auf eine gute Lesbarkeit deiner Texte achten solltest: Es reicht nämlich nicht, dass du über spezielles Fachwissen verfügst, sondern erst die gelungene Vermittlung dieses Wissens macht anderen klar, dass und warum du ein Experte auf deinem Gebiet bist. Eine gute Lesbarkeit unterstützt dich also nicht nur bei deinem Ziel, dein Wissen zu vermitteln, sondern auch dabei, dich selbst als Experte zu positionieren! Das führt im nächsten Schritt dazu, dass der Leser erkennt, welchen Nutzen du ihm bieten kannst – und dazu, dass er deine Dienstleistung in Anspruch nimmt. Diese Aspekte korrelieren direkt miteinander – und deshalb ist Lesbarkeit auch und gerade bei deinem Sach- oder Fachbuch von entscheidender Bedeutung!
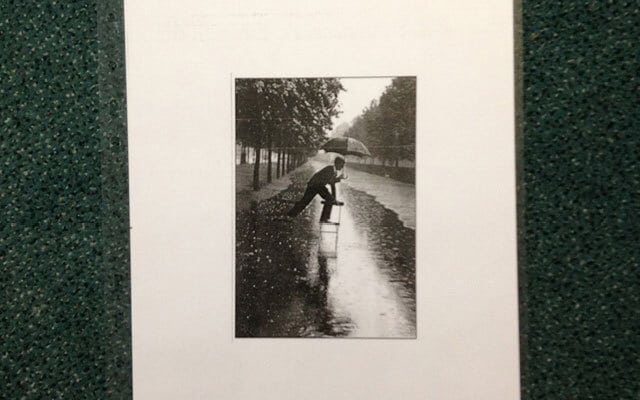
Autorencoach
